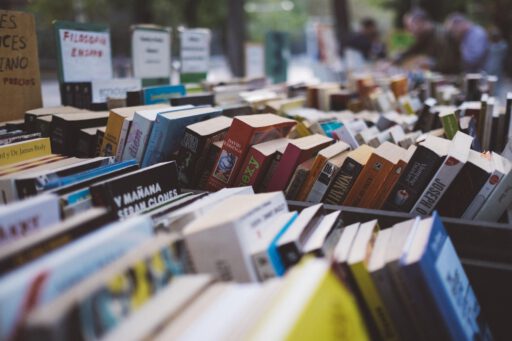Literatur bedeutet für viele Menschen Unterhaltung. Wenn jedoch die Vielfalt und die Belastung unserer Umwelt zum Thema werden, können Texte dann sensibilisieren und zum Umdenken anregen?
„Die Grenzlandprosa von Franziska Füchsl setzt […] eine faszinierende Naturlandschaft in Szene, verschweigt aber auch nicht deren kulturelle Prägungen – und Verheerungen“. So beschreibt das Umweltbundesamt das Werk, mit dem die Autorin Franziska Füchsl den diesjährigen Deutschen Preis für Nature Writing gewonnen hat. Der Preis wird jährlich gemeinsam durch das Amt, den Verlag Matthes & Seitz Berlin und die Stiftung Kunst und Natur vergeben.
Nature Writing ist ein Genre der Literatur, das vor allem in den USA und Großbritannien vertreten ist, schreibt das Umweltbundesamt weiter. Füchsl wiederum definiert diese Art des Schreibens nicht als Genre. Sie hinterfragt: „Lässt sich Natur schreiben? Ist literarisches Schreiben nicht immer Kunst und etwas Verfertigtes, ein Werkstück?“. Inwiefern die Umwelt geschrieben werden kann, ist eine umstrittene Meinung unter Kunstschaffenden. Schriftstellerin Ulrike Draesner hält es für schwierig, Texte über die Natur „in Menschensprache“ zu verfassen, da die Natur selbst diese nicht spricht. Sie versucht, zwischen den beiden Sprachen zu übersetzen. Dabei solle der allgemeine Fokus im Nature Writing nicht auf den Menschen gelenkt werden. Dieser ist, so sagt sie, lediglich „Teil einer größeren Einheit“.
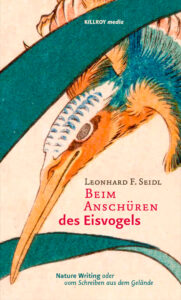
Vermittlung zwischen Natur und Gesellschaft
Dass jedoch gerade das Zusammenspiel aus Mensch und Natur der Kern des Nature Writing sein kann, macht Schriftsteller und Journalist Leonhard F. Seidl deutlich. In seinem Buch „Beim Anschüren des Eisvogels“, das im August dieses Jahres erscheint, erklärt er den Sinn des Schreiben. „Es geht darum, in die Natur zu gehen, diese Erfahrung zu verschriftlichen und literarisch zu gestalten und diese Erfahrung auf die Lesenden zu übertragen“, schreibt der Autor in dem Buch. Nature Writing könne „eine Vermittlerfunktion zwischen Natur und Gesellschaft“ einnehmen, eine Art „Revolution“ voranbringen. Die Texte können mehr als unterhalten. Für Schriftsteller*innen wie Seidl hat Literatur Macht; sie kann zum Nachdenken anregen, Bewusstsein schaffen. Das Genre, wenn man es so bezeichnen will, gibt es dabei schon seit Jahrhunderten. Seidl selbst nennt den Briten Gilbert White als Gründer der Textart. Dieser hat im Jahr 1789 „Die Erkundung von Selborne durch Reverend Gilbert White“ veröffentlicht, das dem Nature Writing zugeordnet werden könne. Es handelt von Whites Beobachtungen der Pflanzen und Tieren in seiner Heimatstadt.
„Manche Dinge werden erst dadurch interessant, dass sie zu schwinden drohen“
Obwohl zwischen den Urtexten des Nature Writing und heutigen Veröffentlichungen mehr als zwei Jahrhunderte liegen, scheint das Genre nur an Relevanz zu gewinnen. Nachrichten über Umweltkatastrophen, Artensterben und Erderwärmung sind regelmäßig Teil des Alltags.
Denise Reimann ist Literaturwissenschaftlerin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie erklärt: Nature Writing kann allein durch die Beschreibung von Natur dafür sensibilisieren, wie vielseitig diese ist und wie stark wir mit ihr verbunden sind. Dabei sei zu bedenken, dass die Zielgruppe des Genres vor allem Personen sind, die sich für Naturthemen interessieren und dafür bereits sensibilisiert sind. Aber: Das Genre kläre auf und vermittle Wissen durch die Benennung und Beschreibung von Tieren, Pflanzen und Phänomenen. Leser*innen können eine emotionale Verbindung zur Natur aufbauen. Der Klimawandel, so Reimann, kann oftmals als „Folie“ für neue Nature-Writing-Texte verstanden werden. Texte, die diese Auswirkungen in den Fokus stellen, würden Betroffenheit, aber auch Handlungsbereitschaft erzeugen. Literatur habe die Kraft, Hoffnung zu geben und alternative Umgangsweisen mit Natur darzustellen. „Protagonist*innen, die tatsächlich vom Klimawandel betroffen sind, gab es lange nur in Science-Fiction-Welten“, erklärt die Literaturwissenschaftlerin. Solche Figuren würden immer mehr in realistische Gegenwartserzählungen vorrücken und den Klimawandel sowie unsere Beziehungen zur Natur greifbarer machen. Gerade das mache das Genre des Nature Writing zukunftsfähig. „Manche Dinge werden erst dadurch interessant, dass sie zu schwinden drohen“, fasst Reimann zusammen.

Für Umweltthemen sensibilisieren
Literaturwissenschaftlerin Sarah Maaß von der Universität zu Köln beschreibt Nature Writing als Einladung: „Ob diese Einladung angenommen wird, ist eine andere Frage“. Denn wie die Texte letztendlich auf das Umweltbewusstsein der Leser*innen wirken, lasse sich pauschal nicht beantworten. Das Potenzial des Genres sieht sie ebenfalls in seiner Sensibilisierung für Umweltthemen, da „im weitesten Sinne wissenschaftliche, sinnliche und ästhetische Wahrnehmungsweisen“ zusammengebracht werden. Die Leserschaft habe die Möglichkeit, reflektiert über ihren Umgang und ihre Verbundenheit mit der Natur nachzudenken.
Nature Writing – das ist also erstmal ein weit gefasster Begriff, der unterschiedlich interpretiert werden kann. Klar scheint jedoch zu sein: Die Natur soll im Mittelpunkt stehen. Gerade das gibt dem Genre Bedeutung. Wenn uns bewusst wird, wie sich unser Lebensstil auf die Natur auswirkt, in und mit der wir leben, dann kann das etwas bewegen. Es kann unsere Gefühle für die Natur verstärken und zum Handeln aufrufen. Nature Writing liegt am Puls der Zeit. Und vielleicht ruft es seinen Leser*innen auch ins Bewusstsein, wieso die Umwelt unseren Schutz bedarf.