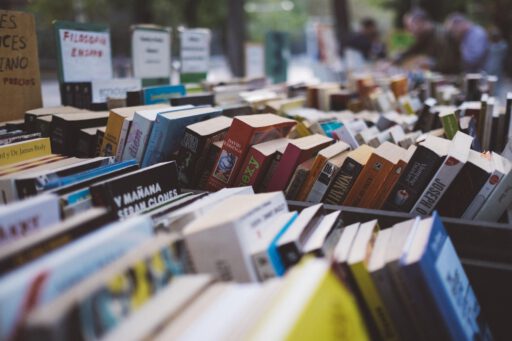Zukunft ist out, nur noch das Heute zählt? Leben wir im Zeitalter der Zukunftsvermeidung oder kratzen wir noch die Kurve? Warum wir uns doch noch ein Leben in Gemeinschaft, Natur und Technik vorstellen sollten –– ein Kommentar.
Utopien haben seit jeher die Funktion, Gesellschaften zum Nachdenken anzuregen: Sie entwerfen alternative Welten, die unsere Gegenwart spiegeln und gleichzeitig Möglichkeiten für eine andere Zukunft eröffnen. Nun würde man denken, dass gerade in Zeiten größerer gesellschaftlicher Umbrüche, wie wir sie heute in globalem Maßstab erleben, das Nachdenken über neue Zukünfte wieder angesagt ist. Nur: Wo sind sie denn hin, die Geschichten über geglückte Revolutionen im Spätkapitalismus, die sagenhaften Ideen zur Energiegewinnung und soziale Experimente mit glücklichem Ausgang?
„Es ist so unwahrscheinlich wie unverständlich:
Die Utopie ist uns abhandengekommen.“
Sicher – die Realitätsflucht ist in Mode. Realitätsvermeidungsstrategien sind heute angesagt wie selten zuvor. Das Morgen zählt nicht mehr, das Heute wird zelebriert! Doch was bedeutet das? Denken wir nicht mehr an die Möglichkeiten der Zukunft? Dafür spricht, dass auch klassische Dystopien nicht mehr angesagt sind. Die großen Sci-Fi Bestseller der späten 90er Jahre und frühen 00er Jahre („The Matrix “, „Bladerunner“, und andere) oder die Teenie-Romanverfilmungen über autoritäre Regime mit tödlichem Ausgang („The Hunger Games“, „Divergent“, „Maze Runner“) scheinen Relikte vergangener Popkulturzeiten.
Solch gängige Sci-Fi Dystopien wurzeln in der Angst vor einem sich rasant entwickelndem technischen Fortschritt – auch Cyberpunk genannt. Im Cyberpunk wird der fragile sozial-gesellschaftliche Zusammenhalt nicht langfristig sichergestellt, sondern jeweils kurzfristig mit ständiger Überwachung, gewalttätigen Regimen und technischen Lösungen verhindert. Dazu gehören Roboter, Künstliche Intelligenz und Umweltkatastrophen genauso wie weltumspannende Unternehmen und furchterregende Machthaber*innen.
Allzu viel davon scheint mittlerweile in unserem Alltag angekommen – zumindest gefühlt. Tech-Milliardäre bauen ihre eigenen Bunker, Prepper warten auf den Tag X, Politiker*innen fantasieren vom Mauerbau und einem starken Staat. Die Dystopie ist – zumindest in der medialen Berichterstattung – zu unser aller Realität geworden.
Die Sonne als Antrieb: für Energie und soziale Wärme
Doch es gibt auch Gegenbewegungen. Die Idee des Solarpunks ist mittlerweile eine der bekanntesten. Sie spannt den Bogen vom künstlerisch-ästhetischem Genre hin zu einer sozialen Bewegung. Statt sich auf den Untergang zu fixieren, entwirft Solarpunk positivere Szenarien: Im Kern geht es um die Vorstellung einer Gesellschaft, die im Einklang mit Natur und Technologie lebt.
„Mit technischen Fortschritten muss auch eine soziale Evolution mit einhergehen, die sich auf Toleranz, Mitgefühl und einem universalen Verständnis für Mensch, Tier und Natur stützt.“
Anders als klassische Utopien, die oft in unerreichbarer Ferne bleiben, versteht sich Solarpunk auch als praktische Utopie. Es geht nicht um Perfektion, sondern um eine Richtung: den Aufbau realer Alternativen, die Schritt für Schritt umsetzbar sind. Beispiele dafür finden sich heute schon in Gemeinschaftsgärten, Urban-Farming-Projekten, solidarischen Ökonomien und Open-Source-Technologien.
Mit technischen Fortschritten muss auch eine soziale Evolution mit einhergehen, die sich auf Toleranz, Mitgefühl und einem universalen Verständnis für Mensch, Tier und Natur stützt. Solarpunk zeigt sich pragmatisch und begreift Utopien nicht als ferne Wunschbilder, sondern als Werkzeuge der Vorstellungskraft, die aktuelle Veränderungen inspirieren sollen. Alle Identitäten, Kulturen und Religionen müssen mit eingeschlossen werden.
Ästhetik zwischen Natur und Technik
Die Zukunftsvision mit klimaschonender Lebensweise, Hightech-Lösungen für menschliche und tierische Bedürfnisse, ethisch vertretbarer Landwirtschaft und plastikfreien Meeren hat ihre Ursprünge in der Literatur des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Ernest Callenbachs Roman „Ecotopia“ (1975) gilt vielen als Vorläufer. Literatur mit feministischer Weltsicht und Zukunftsentwürfen waren für den Solarpunk wegweisend. Dazu gehören insbesondere die Arbeiten der Science-Fiction-Autor*innen Ursula K. Le Guin („The Carrier Bag Theory of Fiction“, 1986), Kim Stanley Robinson („The Three Californias Trilogy“, 1984 bis 1990) und Octavia E. Butler („Xenogenesis“, 1987 bis 1989).
Solarpunk zieht in seiner Ästhetik Inspiration aus vergangenen Popkulturszenen, insbesondere den Alternativszenen. Ein Beispiel sind die Filme von Studio Ghibli, einem japanischen Animationsstudio, das mit Filmen wie „Nausicaä aus dem Tal der Winde“ (1984) oder „Mein Nachbar Totoro“ (1988) bekannt wurde. In den Animationsfilmen erscheint die Natur nicht als zu bezwingender Gegner, sondern als Kraft, die mit dem Menschen koexistiert. In den Filmen von Studio Ghibli spielt die Welt der Geister und Spiritualität spielen eine wichtige Rolle, ohne die Handlungsfreiheit der Protagonist*innen einzuschränken. Es gibt eine Besinnung auf die Kräfte der Natur, ohne in Romantik zu verfallen. Ureigene Möglichkeiten zur Selbstregeneration und die Natur als eigener Akteur werden, wie auch später im Solarpunk, respektiert und genutzt, ohne sie dabei zu zerstören.
Hochtechnologisierte Gesellschaften müssen nicht zwingendermaßen ausbeuterisch mit unseren Lebensräumen umgehen.
Solarpunk ist keine bloße Vision, sondern spiegelt sich auch in realen Projekten wider. In vielen Städten entstehen Urban-Gardening-Initiativen (z. B. das Berliner Projekt „Prinzessinnengarten”). Wie bereits versiegelte Flächen wieder in grüne Aufenthaltsräume verwandelt werden können, zeigt die Pariser Stadtregierung unter der Führung von Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Energie-Communities erproben gemeinschaftliche Modelle für Solar- und Windstrom, bei denen Nachbarschaften unabhängig von großen Konzernen saubere Energie erzeugen und teilen. All das sind Beispiele für die Anwendungen von Utopie im Stadtbild.
Luxusarchitektur statt Gemeinwohlökonomie?
So wirklich in der Gesellschaft angekommen scheinen viele Utopien aber immer noch nicht. Woran könnte das liegen? Wie bei jeder Utopie gibt es auch bei Solarpunk kritische Stimmen. Utopische Formen des Zusammenlebens werden häufig als „Hobby der Reichen“ abgetan. Einige befürchten, dass die Bewegung in eine rein ästhetische Richtung abgleitet – in „grüne“ Luxusarchitektur für wenige Privilegierte.
„Solarpunk ist technikbejahend und antidystopisch, ohne in die kapitalismusbejahende Falle der Tech-Giganten miteinzustimmen.“
Solarpunk ist Theorie, Genre und Praxis. Was alle vereint: Es ist möglich, sich die Zukunft technikbejahend und antidystopisch vorzustellen. Solarpunk kann uns konkrete Handlungsanleitungen bieten, indem es sichtbar macht, wie ein Leben im Einklang mit Natur, Technologie und Gemeinschaft aussehen kann, ohne in die kapitalismusbejahende Falle der Tech-Giganten einzustimmen.
Damit eine Utopie aber wirklich erfolgreich sein kann, muss sie sich sozialen Fragen stellen. Um glaubwürdig zu bleiben, muss Solarpunk daher stets den Anspruch einlösen, nicht nur schöne Bilder zu produzieren, sondern auch reale, inklusive und gerechte Alternativen aufzeigen.